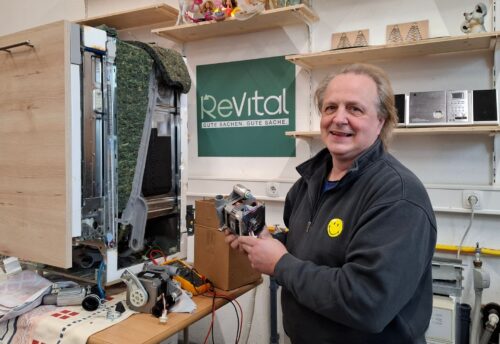Die jüngst von Greenpeace veröffentlichte GPS-Recherche zu den Wegen von Altkleidern hat eindrucksvoll gezeigt: Das derzeitige Sammel- und Verwertungssystem für Textilien in Österreich ist lückenhaft. Dadurch läuft gespendete Kleidung Gefahr, ihren eigentlichen Zweck zu verfehlen und stattdessen um die halbe Welt transportiert, verbrannt oder falsch entsorgt zu werden – alles auf Kosten der Umwelt.
Als Re-Use Austria, Interessenvertretung der sozialwirtschaftlich ausgerichteten Re-Use-Betriebe, begrüßen wir diese Diskussion ausdrücklich. Denn sie zeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Sammel- und Sortiersystem ist – und dass es politische Maßnahmen braucht, um eine verantwortungsvolle Verwertung von Textilspenden zu gewährleisten.
Kapazitäten vollkommen unzureichend
Dass das Textil-Sortiersystem in Europa und insbesondere in Österreich dringend ausgebaut werden muss, darauf weist Matthias Neitsch, Geschäftsführer von Re-Use Austria, bereits seit Jahren hin. Eine 2025 in Kraft getretene EU-Vorgabe hat die Situation noch einmal verschärft: In der EU-Abfallrahmenrichtlinie wird festgelegt, dass Alttextilien ab 2025 separat gesammelt werden sollen, um sicherzustellen, dass Textilabfälle im ersten Schritt der Vorbereitung zur Wiederverwendung zugeführt werden. Laut EEA reichen die derzeitigen Sammlungs-, Sortier- und Recyclingkapazitäten für diese Maßnahme allerdings bei weitem nicht aus. In Österreich verfügt von den neun Bundesländern nur eines über eine professionelle Anlage für die Vollsortierung von Altkleidern, und zwar Vorarlberg mit Carla-Tex der Caritas. Diese kann jedoch nur Altkleiderspenden aus Vorarlberg bearbeiten und auch dort nicht die gesamte Sammelmenge.
Die restlichen gesammelten Altkleider aus Österreich werden nur grob vorsortiert, primär für den Verkauf in eigenen sozialwirtschaftlichen Re-Use-Shop. Matthias Neitsch dazu im Falter-Interview: „Wir können vielleicht zehn Prozent der gesammelten Altkleider in Österreich verkaufen oder verschenken.“ Für mehr reichen die Lagerkapazitäten und die Marktnachfrage nicht aus.
Vollumfängliches Umdenken notwendig
Generell können sozialwirtschaftliche Betriebe nur intakte, saubere Kleidung weiterverkaufen. Dies ist jedoch leider immer noch nur bei etwa der Hälfte der gespendeten Kleider der Fall. Für den verbleibenden Teil fehlen oft geeignete Recyclingstrategien, die Infrastruktur oder die notwendige Finanzierung. Dadurch kann es passieren, dass diese Kleidung ins Ausland verkauft wird, wo sie entweder wiederum weiterverkauft, in Müllverbrennungsanlagen entsorgt oder im schlimmsten Fall in der Umwelt abgelagert wird. „Eine Garantie, dass so etwas nicht passiert, kann niemand geben.“, so Neitsch.
Daher ist es notwendig, bereits früh im Kreislauf anzusetzen – nämlich bevor die Sachspende im Altkleidercontainer, bzw. – noch besser – das Ultra-Fast-Fashion Produkt überhaupt im Kleiderschrank landet.
„Ultra-Fast-Fashion-Teile wie von Shein oder Temu können in der Regel nicht weiterverkauft werden.“, so Neitsch.
Generell gilt: Vor einer Kleiderspende sollten die Produkte auf Intaktheit und Sauberkeit überprüft werden. Wer zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen möchte, sollte nur gut erhaltene Kleidungsstücke in die Altkleidercontainer oder direkt in die Re-Use-Shops bringen. Als Maßstab gilt: Nur die Teile spenden, die man auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis weitergeben würde. Kaputte Kleidungsstücke gehören nicht in den Altkleidercontainer, sondern in den Restmüll.
Handlungsbedarf seitens der Politik, aber Konsument:innen können aktiv mitentscheiden
Die wirksamste Maßnahme, um solchen Vorkommnissen, wie von Greenpeace berichtet, entgegenzuwirken ist jedoch immer noch den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. An dieser Stelle verfügen Konsument:innen oft über einen unterschätzten Einfluss. Wer weniger auf Werbung reagiert und beim Konsum vermehrt auf Secondhand-Produkte setzt, sorgt dafür, dass weniger neue Produkte auf den Markt gelangen und die bestehenden Systeme nicht derart überlastet werden.
Dennoch besteht vor allem auch auf Seiten der Politik klarer Handlungsbedarf, um eine grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen zu erwirken. Dazu zählen etwa die Schaffung von einem fairen Einkommen in Produktionsländern, der Aufbau seriöser, bilateraler Handelsbeziehungen und die Ermöglichung zielgerichteter, bedarfsorientierter Gebrauchtkleider-Exporte auf Bestellung. Zentral ist zudem die Definition von Mindestkriterien für die Textillieferkette sowie die Übernahme von Lieferkettenverantwortung sowohl bei der Herstellung neuer, als auch bei der Verwertung gebrauchter Kleidung.
Um diese Kriterien gewährleisten und somit ein funktionierendes, für alle beteiligten Partner:innen faires System der globalen Altkleiderbewirtschaftung zu schaffen, sind transparente Lieferketten unumgänglich.
Re-Use Austria hat zum Thema „Gebrauchtkleidung in Afrika“ ein Positionspapier verfasst, in dem alle genauen Forderungen an die Politik nachgelesen werden können.