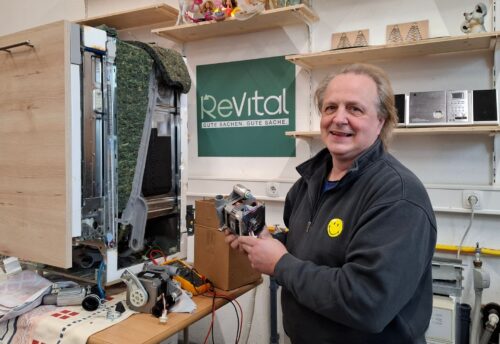Wo landen unsere Kleiderspenden wirklich? Das Thema Kleiderspenden betrifft uns alle: Fast jede:r hat schon einmal Kleidung gespendet oder Second-Hand gekauft. Doch wie nachhaltig funktioniert dieser Kreislauf wirklich? Ein Themenabend im WirkRaum Dornbirn, organisiert von Caritas Vorarlberg und Greenpeace, gewährte spannende Einblicke.
Die unsichtbare Reise der Altkleider
Der Aufschrei war groß: Greenpeace verfolgte im Rahmen eines groß angelegten Experiments mittels Trackern den Weg von 20 gespendeten Kleidungsstücken. Das ernüchternde Ergebnis: Nur drei Stücke fanden direkt eine neue:n Träger:in. Die Hälfte landete als Exportware in afrikanischen oder asiatischen Ländern, oft ohne funktionierende Abfallwirtschaft – ein Stück reiste sogar 11.000 Kilometer, bevor es vermutlich vernichtet wurde. Das Experiment wirft Licht auf ein großes Problem: Zu viele Textilien enden als Müll und belasten Mensch und Umwelt.
Vorarlberg als Vorreiter im Bundesländervergleich
Für viele Verbraucher:innen stellte sich nach der Veröffentlichung der Greenpeace-Studie die Frage: Sind Kleiderspenden denn überhaupt noch sinnvoll? Re-Use Austria-Geschäftsführer Matthias Neitsch hat dazu ein Interview in der Kleinen Zeitung gegeben und hob hervor, dass es diesbezüglich in Österreich dringenden Ausbaubedarf in Sachen Infrastruktur gibt. Im ganzen Land gibt es nämlich nur ein Sortierzentrum, das eine Vollsortierung betreibt, und zwar das carla Tex in Hohenems. Vorarlberg nimmt dementsprechend in Sachen Textilsammlung und -sortierung eine Vorreiterrolle ein. Gemeindeverband, Caritas und die Bevölkerung kooperieren auf vorbildliche Weise und können daher auch die größte Sammelmenge pro Kopf vorweisen.
Kreislaufwirtschaft beginnt mit Konsumverhalten
Trotzdem gilt: Nur etwa 12 Prozent der gespendeten Kleidung finden hierzulande neue Abnehmer:innen (Quelle: Re-Use Austria Markterhebung 2024). Der Rest gelangt auf den internationalen Markt, während 20% als Restmüll teuer entsorgt werden müssen.
Um Mode nachhaltiger zu gestalten, braucht es daher ein weiter gefasstes Umdenken, wie auch in der Diskussionsrunde beim Themenabend veranschaulichte: Tabea Böhler (Fachhochschule Dornbirn) betonte die Bedeutung eines geringeren Konsums und stellte „Refuse“ – den bewussten Verzicht auf unnötige Käufe – als wichtigsten Hebel gegen Überproduktion heraus. Barbara Paul (Getzner Textil) zeigte aktuelle Fortschritte bei nachhaltigen Verfahrenstechniken auf, wies jedoch darauf hin, dass recycelte Textilien, insbesondere aus Baumwolle, derzeit noch nicht die Qualität neuer Produkte erreichen. Die Expertinnen machten deutlich, dass technologische Weiterentwicklungen und ein verändertes Konsumverhalten entscheidend für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sind.
Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Das Thema Altkleider betrifft Konsument:innen, Industrie und Politik gleichermaßen. Neue Konsummuster und konkrete politische Maßnahmen sind notwendig, um wirksame Lösungen zu finden und die Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten. Greenpeace formulierte diesbezüglich bereits im Rahmen der Studie klare Forderungen an die Politik: ein Exportverbot für unsortierte Altkleider und die Einführung einer Abgabe für Textilproduzenten zur Finanzierung der Entsorgung (erweiterte Herstellerverantwortung). Eine weitere Forderung ist ein Anti-Fast-Fashion Gesetz nach französischem Vorbild, zur Eindämmung der Kleider-Überproduktion und Billigimporten aus China. Was allerdings noch fehle, ist der politische Wille, hier auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, so Stefan Stadler, wissenschaftlicher Experte bei Greenpeace Österreich.